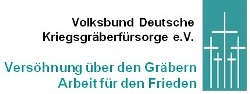Inhalt Seitenleiste
Ausstellung Aktives Museum Südwestfalen

Luftschutzbunker am Obergraben mit Bild der ehemaligen Synagoge
An der Außenwand des Luftschutzbunkers am Obergraben fällt ein 12 qm großes Foto der Siegener Synagoge auf. Sie stand an diesem Ort. Eine Tafel informiert über die unterschiedliche Nutzung dieses Ortes in der Innenstadt von Siegen: Synagoge - Luftschutzbunker - Museum.
Daneben befindet sich an der Bunkerwand eine Eisenskulptur des israelischen Künstlers Dan Richter-Levin. Sie trägt den Titel: "Innere Ordnung - eingerahmt."
An einer Bruchsteinmauer links vor dem Eingang befindet sich eine dort 1965 angebrachte Gedenktafel. In jenem Jahr fand erstmals eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Toten aus der ehemaligen jüdischen Gemeinde Siegen statt. Solche Gedenkstunden werden alljährlich am 9./10. November von der 1959 gegründeten Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ausgerichtet. Auf der Tafel ist für die Eröffnung der Synagoge irrtümlich das Jahr 1906 angegeben. Es muss richtig 1904 heißen.
Die Besucher betreten den Lern- und Gedenkort durch ein schmiedeeisernes Tor, auf dem ein siebenarmiger Leuchter (Menorah) angebracht ist.
Nun schauen sie auf ein Foto der ehemaligen Synagoge der Stadt, die an diesem Ort von 1904 - 1938 stand. Daneben befindet sich eine Gedenktafel mit den Namen, Lebensdaten und Adressen der Opfer aus der jüdischen Gemeinde Siegens. Diese Tafel wurde 1988 eingeweiht.
Beim Betreten der Museumsräume fällt der Blick auf eine Mesusa am rechten Türpfosten. Gläubige Juden berühren diese beim Eintritt in einen Raum und sprechen dazu einen Segen. Durch Berühren einer Klangwand können die Besucher sich akustisch auf den Besuch der Ausstellung einstimmen.
Im Jahr 2021 wurde der Zugang um eine Metalltreppe an der Frontseite des Museums ergänzt. Über diese gelangen Besucher in das erste Obergeschoss des Bunkers, in dem aktuell die Sonderausstellung zu sehen ist.
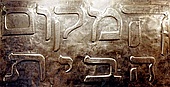
Klangwand im Aktiven Museum. Zum Anhören der Klangbeispiele bitte Anklicken (mp3-Datei, 858 kb)
Diese akustische Wand wurde von den Siegenern Gabi Bosch und Rolf Großmann erdacht und gestaltet. Sie trägt die hebräische Aufschrift "Hamakom" und "Habai"" ("Der Ort" - "Das Haus"). Dies soll an den Tempel in Jerusalem erinnern. Durch Berühren der Tafel ertönen Klangdokumente wie z. B. Synagogengesänge, jiddische Lieder, aber auch Fragmente aus Reden, Naziparolen, Kriegsgeräusche usw.
Regelmäßig bietet das Museum wechselnde Sonderausstellungen zur Geschichte des Nationalsozialismus an. Seit dem 17. Oktober 2023 und noch bis zum 15. März 2024 wird der bisher wenig beachtete Aspekt der Zwangsarbeit im Siegerland dargestellt, an welchen die Fragen gestellt werden: „Verschleppt. Ausgebeutet. Vergessen?“
Die Gegenüberstellung von Opferbiografien und den Ergebnissen der Forschung macht deutlich, dass diese kein Randphänomen, sondern im Gegenteil ein zentraler Teil der regionalen Geschichte war. So war Siegen in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ein bedeutender Standort für die nationalsozialistische Rüstungsindustrie.
Neben dem Einsatz moderner Medien, ist die Sonderausstellung ganz bewusst unter einem hohen Anteil partizipativer Elemente gestaltet worden-sowohl für den interessierten Besucher als auch für einst betroffene Unternehmen. Diese wurden eingeladen, gemeinsam mit dem pädagogischen Personal die eigene Geschichte aufzuarbeiten und einen Beitrag zur künftigen Forschung beizusteuern.
Dauerausstellung
Derzeit erarbeitet das Aktive Museum eine umfangreiche Dauerausstellung innerhalb derer die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde, als auch die Geschichte des Erinnerungsortes selbst durch ausgewählte, authentische Zeugnisse und Quellen verschiedenen Charakters dargestellt werden soll.
Zur Förderung der Entwicklung der Dauerausstellung erhält das Museum eine umfangreiche finanzielle Zuwendung durch die NRW-Stiftung.
.